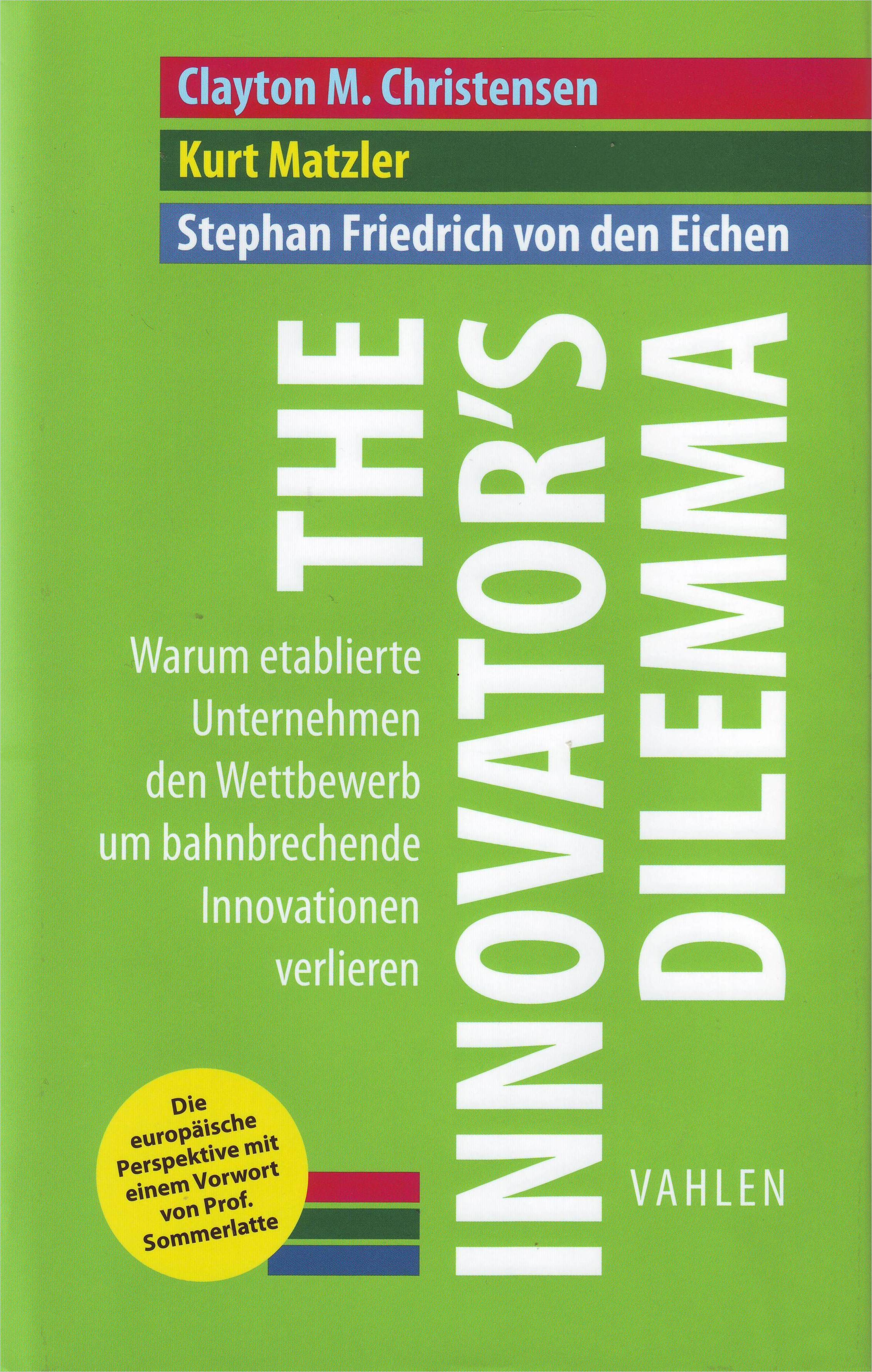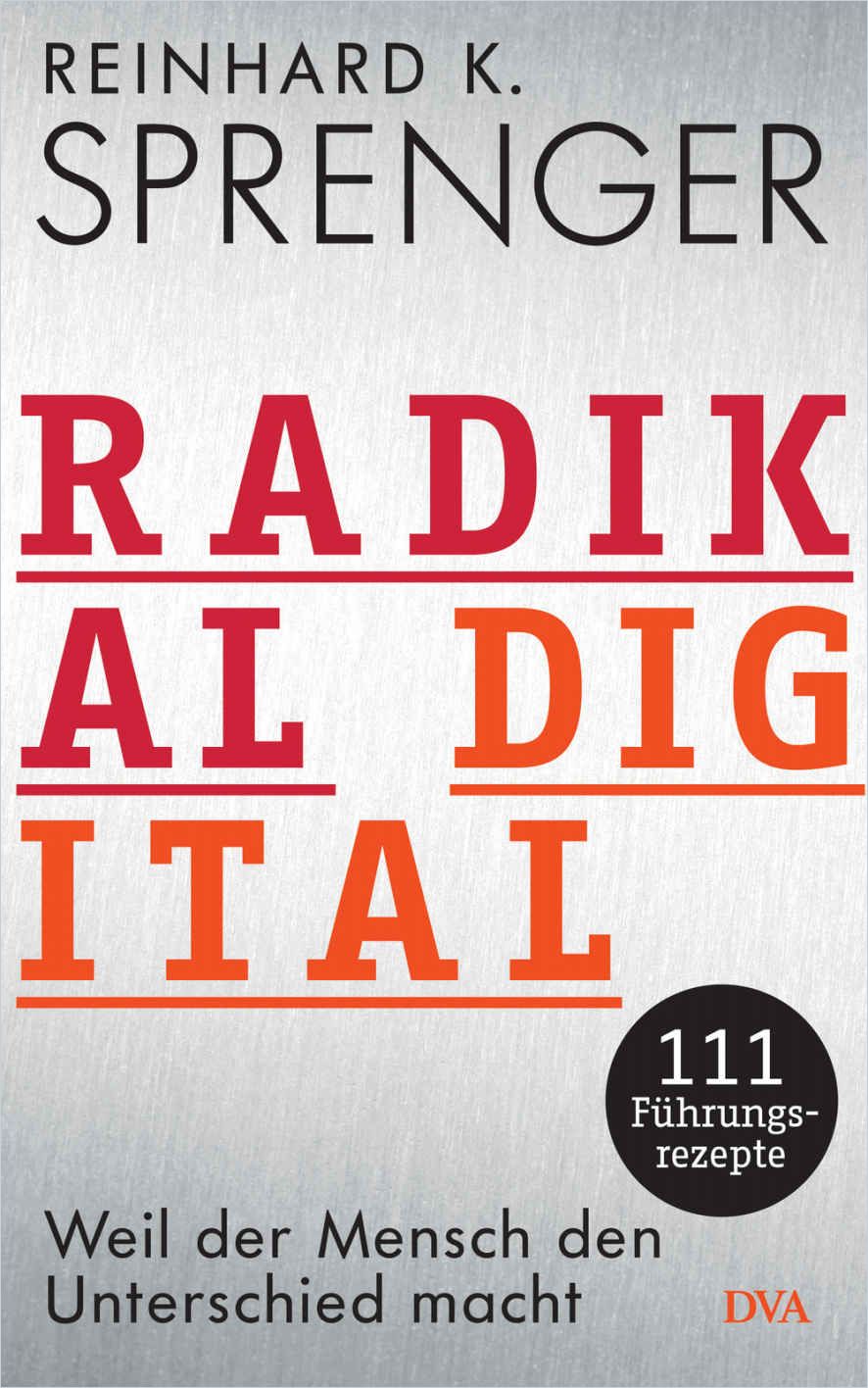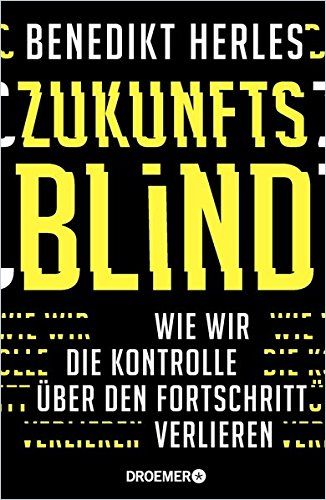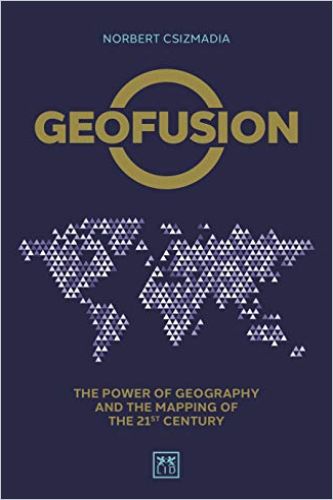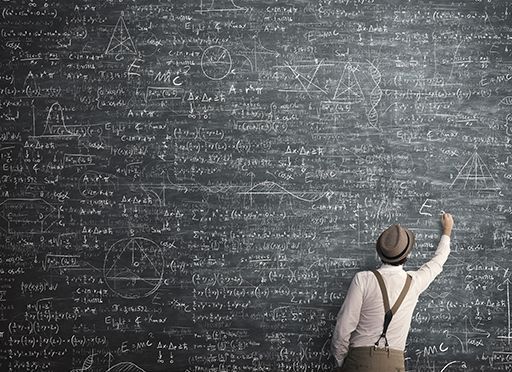„Deutschland verschläft die digitale Transformation.“

getAbstract: Herr Herles, wer Ihr Buch „Zukunftsblind“, das soeben mit dem getAbstract International Book Award ausgezeichnet wurde, über den oft naiven gesellschaftlichen Umgang mit neuen Technologien liest, bekommt den Eindruck, Sie seien ein echter Pessimist. Stimmt das?
Benedikt Herles: Nein, ganz und gar nicht. Richtig ist: Mein Buch handelt von neuen Technologien und den Folgen ihres Einsatzes für Gesellschaft, Politik und Wirtschaft. Die Technologie selbst ist dabei weder gut noch schlecht – es kommt drauf an, was man damit anstellt. Grundsätzlich gilt: Technologien lösen Probleme. Und deshalb brauchen wir sie dringend, um die großen Herausforderungen unserer Zeit sinnvoll anzugehen. Vom Klimawandel über die Vermüllung der Ozeane mit Plastik bis hin zur demografischen Entwicklung in vielen Industrienationen – all diese Probleme können nur mit technologischen Innovationen gelöst werden. Wenn mich etwas pessimistisch stimmt, dann eher der Umstand, dass diese Chancen in aktuellen Debatten oft verkannt, wenn nicht sogar bewusst ignoriert werden.
Sie meinen: in Deutschland herrscht ein gewisser Technik- und Zukunftspessimismus?
Das gilt nicht nur für Deutschland, sondern für den ganzen deutschsprachigen Raum und hat kulturelle Ursachen. Während Angelsachsen im übertragenden Sinn vom Ritt nach Westen oder vom Flug zum Mond träumen, überlegen Mitteleuropäer eher, was dort Ungewisses auf sie warten könnte. In der Gesellschaft weit verbreitete Zukunftsängste sind aber nur die eine Seite der Medaille. Die andere ist die zum Teil daraus resultierende politische Kurzsichtigkeit. In meinem Buch nenne ich es „das politische Innovator‘s Dilemma“. Der Begriff kommt eigentlich aus der Wirtschaft und beschreibt die Herausforderung von Markt- und ehemaligen Innovationsführern, sich selbst neu zu erfinden. Große Organisationen sind traditionell gut darin, bestehende Prozesse und Produkte zu optimieren, sind aber häufig eher schlecht darin, radikal Neues zu erschaffen und wiegen sich leicht in trügerischer Sicherheit. Ähnliches kann man auch für die Gesellschaft als Ganzes diagnostizieren.
Mitunter werden sie dann blind für Innovationen jenseits des eigenen Betriebs und kriegen gar nicht mit, dass letzterem irgendwann die Existenzgrundlage am Markt entzogen wird.
Genau.
Schuld an dieser teilweisen Blindheit ist in erster Linie der Druck des Kapitalmarkts, also von Shareholdern und Aktienanalysten, die kurzfristige Strategien und direkt marktgängige Anpassungen von Produkten mehr lieben als kapitalintensive Wagnisse.
Wo das optimierte Quartalsergebnis dauerhaft wichtiger ist als mittel- oder langfristig orientierte Innovationen, werden große Sprünge unmöglich. So entstehen dann strategische Nachteile, die man in einer aufkommenden Konkurrenzsituation kaum mehr wettmachen kann.
In der Wirtschaft ist das kein fortschrittshemmendes Problem, denn die Konkurrenz, die diesen Mangel an Innovationsarbeit dankend ausnutzt, sorgt für „kreative Zerstörung“. In der Politik sieht das anders aus?
Zunächst: Wirtschaft und Politik ähneln sich systemisch. Statt Quartalsergebnisse haben wir Landtagswahlen, statt Aktionäre haben wir Wähler und Polit-Journalisten, die auf kurzfristige Optimierungen pochen – was in der Politik aber fehlt, ist der Innovationsdruck durch Konkurrenz.
Eigentlich sollte diese Rolle, die in der Wirtschaft am ehesten den Startups und KMUs zukommt, in einer Demokratie von Parteien der Opposition übernommen werden.
Eigentlich. Aber wie viele erfolgreiche Parteien-Startups fallen Ihnen ein? Klar: in Deutschland könnte man aus den letzten dreißig, vierzig Jahren die AfD, die Piratenpartei und die Grünen nennen. Das sind ganze drei! Erstere steht aber nicht für Revolution sondern für Restauration; die Piraten haben sich rasch als nicht politikfähig erwiesen, und die Grünen sind längst das „SAP der Politik“ – ein Produkt der Siebziger und Achtziger, etabliert, akzeptiert, erfolgreich und nur noch selten disruptiv. Da ist also nicht viel Konkurrenz in Sicht, und ich kenne kein Land, wo das ganz anders aussähe. Aber verwundert mich das? Nein. Denn Politiker reagieren – wie Manager – auf Anreize. Und die Anreize, die durch die Wahlentscheide der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland und in anderen Industrieländern gesetzt werden, sind eben nicht besonders zukunftsoptimistisch oder innovationsfreundlich.
Wozu führt das konkret?
Das führt zu politischen Schnellschüssen, die dem Wähler leicht vermittelbar, aber kaum je nachhaltig sind. Wenn es um die Lösung des demographischen Problems geht, heißt die Antwort dann „noch mehr Sozialausgaben“. Wenn es um Wachstum geht, setzt man auf „noch mehr Konsum“ und so weiter. Statt Probleme zu lösen – etwa durch neue Technologien –, bastelt man am Bestehenden herum. Das löst nicht nur keine Probleme, es schafft neue. Ein schönes Beispiel dafür ist die aktuelle Debatte zur Grundrente in Deutschland: Die kostet ab 2025 zwischen vier und fünf Milliarden Euro jährlich, hat aber keinen Innovationseffekt. Zum Vergleich: Wie viel gibt die Bundesregierung für die Förderung der Entwicklung Künstlicher Intelligenzen in Deutschland aus – also für die Erschließung eines riesigen Zukunftsmarkts? Insgesamt drei Milliarden Euro bis 2025! Das ist doch ein krasses Missverhältnis von Konsum und Investitionen – und dieses Signal wird auf der ganzen Welt gehört: Deutschland verschläft die digitale Transformation.
Könnte das auch mit Verständnisproblemen zu tun haben? Das Thema „Digitalisierung“ dominiert viele öffentliche Debatten – was darunter aber konkret verstanden wird, hat mit gesellschaftlichem Wandel wenig zu tun.
Es ist tatsächlich so: Wenn wir „Digitalisierung“ hören, denken wir immer noch zuerst an digitale Tools fürs Leben, von vernetzten Haushaltsgeräten bis hin zu Dating Apps. Aber diese Sichtweise der Digitalisierung greift viel zu kurz und ist sogar gefährlich, weil sie die Sicht auf das verstellt, was ich eine „technologisch-wirtschaftliche Zeitenwende“ nenne. Sie umfasst neben den Digitalisierungsfortschritten im Hinblick auf KI, Internet der Dinge u.a. auch die Biotechnologie und ist gekennzeichnet durch die Schaffung völlig neuer Voraussetzungen von Gesellschaft, Wirtschaft und Zivilisation als Ganzes.
In „Zukunftsblind“ reden Sie diesbezüglich von einer umfassenden „Entmaterialisierung“. Was muss man sich darunter vorstellen?
Alles Stoffliche verliert an Bedeutung. Bisher waren Innovationen immer dinglicher Natur: die Druckerpresse, das Rad, die Eisenbahn, das Telefon. Um sie flächendeckend zur Verfügung zu stellen, mussten passende Distributionsnetze, also Infrastrukturen gebaut werden. Das war sehr kapitalintensiv, und deshalb hat es lange gedauert, die allermeisten Orte zu erreichen. Dieser Umstand führte aber auch zu einer Art Schonfrist für die jeweiligen Gesellschaften, sich dem Wandel anzupassen. Sie konnten sich über Jahrzehnte, Jahre oder zumindest Monate akklimatisieren. Heute können Sie zu null Grenzkosten innerhalb von Sekunden ein Softwareupdate auf Millionen von Endgeräten spielen – und dieses Update kann dramatischen Einfluss auf Ihren Alltag haben. Die Natur des Fortschritts hat sich also verändert, und zwar in historisch unvergleichlicher Weise.
Aber das ist doch eigentlich eine gute Sache: Nicht nur das Stoffliche verliert seine mitunter hemmenden Nachteile, sondern auch der Ort. Wer früher durch Geburt „am falschen Ort“ benachteiligt war, wenn es um die Früchte des Fortschritts ging, ist heute durch bessere Vernetzung viel häufiger unabhängig davon.
Das war das große Versprechen des Internets. Drei Jahrzehnte später sehen wir aber doch genau das Gegenteil:
Der Ort spielt sogar eine größere Rolle als früher, denn es existieren nun einzelne Cluster des Fortschritts, die mehr oder minder in unwidersprochener Eigenregie bestimmen können, wie sich die Lebenswelt aller verändern wird.
Der berühmteste ist das Silicon Valley. Die Wahrheit ist, dass deshalb der Unterschied zwischen Stadt und Land zu-, und nicht abnimmt.
Können Sie das genauer erklären?
Eine Wirtschaft der physischen Güter ist prinzipiell gut für die Provinz, weil dort die Kosten für Material und Arbeit meist geringer sind. Das hieß früher: die Produktion zieht in die Peripherie, da die Stadt zu teuer ist – und diese Entwicklung hilft den ländlichen Regionen, ihren Teil vom Kuchen abzubekommen. Wenn aber die Produktion eine geringere Rolle spielt, etwa in modernen und digitalen Dienstleistungsgesellschaften, geht es nur noch um „Human Capital“ und „Human Skills“ wie Kreativität, Intelligenz, soziale Kompetenz. Dann verliert das Land, denn die besten Köpfe werden in Zentren von Kultur, Wissenschaft und Wirtschaft nicht nur mehr nachgefragt als in ehemaligen Produktions- und Industriestandorten. Fakt ist auch, dass sie nur dort finden, was sie suchen, um ihre Kompetenzen zu verbessern: bessere kulturelle und wirtschaftliche Infrastruktur, ständigen Austausch mit den Besten ihres Faches usw. Man könnte sagen: Die digitale Transformation hat das alte Phänomen Landflucht nicht abgeschafft, sondern sogar intensiviert.
Ein Naturgesetz der Digitalisierung ist das aber doch nicht. Kommt es nicht eher auf die Standortfaktoren an? Das schweizerische Zug etwa war bis vor rund dreißig Jahren ein vergleichsweise verschlafenes, von Industrie und Kleingewerbe dominiertes Kleinstädtchen in der Provinz. Heute nennen sie den Ort „Crypto Valley“, da Zug über das geschickte Setzen der wirtschaftlich-regulatorischen Rahmenbedingungen eine enorme Anzahl von Blockchain-Firmen anlocken konnte und aus dem „Nest“ einen „Hot Spot“ gemacht hat.
Ja, das hat Zug geschafft. In diesem sehr spezifischen kleinen Bereich der Krypto-Wirtschaft, der zuvorderst von der Regulatorik beeinflusst wird, ist Zug stärker als andere. Aber es ist für die Politik vergleichsweise leicht, in einem so spezifischen Bereich schnell viel zu bewirken. Wie viele Startup-Ökosysteme haben es aber geschafft, an den Erfolg eines Silicon Valleys anzuschließen? Keines. Und es wird auch keines schaffen. In Berlin können sie noch so lange von der „Silicon Alley“ reden – das ist und bleibt ein Witz im Vergleich zu dem, was in der Bay Area passiert.
Was müsste sich ändern, damit der Witz kein Witz mehr ist?
Entscheidend ist, dass wir ein unternehmerisches Zukunfts-Narrativ finden.
Die meisten Industrieländer haben überhaupt keine Vision, keine Idee, wohin sie eigentlich steuern wollen in dieser transformativen Zeit.
Deshalb hat Deutschland die weithin bekannte miserable Digitalinfrastruktur, deshalb fördern wir neue Technologien hier nur halbherzig, deshalb glauben viele, mit dem „Digitalpakt Schule“, der W-Lan auf dem Schulhof und iPads und Laptops in den Klassenzimmern installiert, sei die Bildung „digitalisiert“.
Einverstanden. Aber: wie schafft man denn ein proaktiveres „Mindset“?
Zuallererst sollten wir öffentlich darüber diskutieren, welche Zukunft wir uns für Deutschland vorstellen wollen. Und das tun wir gerade nicht, seit Jahren nicht. Vor diesem Hintergrund ist die Bildung wahrscheinlich der größte Hebel zur langfristigen Sicherung von Wohlstand, denn die nächste Generation hat einiges zu verlieren und die Eltern ein ernsthaftes Interesse daran, ihren Kindern das richtige Rüstzeug mitzugeben. Hier sind sich zur Abwechslung auch mal alle Volkswirte einig: soziale Kompetenz und das Lernen selbst sind die gefragten Fähigkeiten in unserer neuen Arbeitswelt.
Wer also fächer- und disziplinübergreifend denken kann, kreativ und teamfähig ist, muss sich vor keiner Automatisierungswelle fürchten?
So ist es. Die reine Informationsvermittlung rückt in den Hintergrund, denn die allermeisten Informationen sind doch heute schon innerhalb von Sekunden auf meinem Endgerät abrufbar, und werden in Kombination mit den jeweiligen Umständen zu brauchbarem, anwendbarem Wissen, wenn ich weiß, was ich damit anfangen will.
Das Filtern von relevantem Wissen in einem Meer aus Informationen ist eine immer individuellere Transformationsleistung, die in Zukunft viel mehr Menschen werden erbringen müssen – jedenfalls, wenn sie erfolgreich sein wollen.
Diese Einsicht spielt in der heutigen Bildungslandschaft aber keine größere Rolle. Wir schicken unsere Kinder immer noch in ein Bildungssystem, das funktioniert, als ob es darum ginge, Arbeiter für die Schraubenfabrik oder fürs Büro der Schraubenfabrik zu qualifizieren – aber nicht darum, mündige Bürger auf ein digitales Zeitalter vorzubereiten.
Ist denn von vielen Mitbürgern nicht mehr gewollt?
Doch doch. Immer wieder stehen besorgte Eltern vor mir, die mich fragen, was die Kinder wohl am besten studieren sollen, wenn sie in Zukunft erfolgreich und zufrieden leben möchten. Wissen Sie, was ich darauf mit voller Überzeugung antworte? „Völlig egal, was Ihre Kinder studieren – Hauptsache ist, dass sie studieren!“ Denn ein Hochschulstudium regt immer dazu an, über Grenzen hinwegzudenken, sorgt für wachsende Lernkompetenzen und die Erschließung bislang unbekannter sozialer Welten.
Apropos Lernen: Welche Staaten gehen Ihrer Ansicht nach besser mit dem Wandel um als Deutschland? Wo kann man etwas lernen im Hinblick auf Reformen – zum Beispiel, wenn es um das von Ihnen in Ihrem Buch hart kritisierte deutsche Steuersystem geht?
Ich weiß nicht, ob es da einen leuchtenden Stern gibt. Ehrlich gesagt glaube ich, dass wir vielerorts ein komplettes Umdenken, ein systemisches Umdenken brauchen, keine Justierungen. Denken Sie nur ans deutsche Steuersystem: Aktuell werden Arbeits- oder Lohneinkommen in Deutschland zum Teil stärker besteuert als Kapitaleinkommen. Und das in einer Situation, da die Lohneinkommen in den Industrienationen ohnehin unter besonderem Druck stehen. Die Lohnquote am Volkseinkommen sinkt, die Kapitalgewinnquote steigt – seit den 1980er Jahren, was zu einer ökonomischen Polarisierung in der Gesellschaft führt.
Ist das reformierbar, indem man kleine Anpassungen vornimmt? Ich glaube nicht.
Mein Vorschlag: das alte System durch ein neues ersetzen, und alle, wirklich alle Einkünfte gleich besteuern. Das ist einfach, effizient, fair. Und nur ein Beispiel von vielen, wie unser Leben in Zukunft wirklich „smarter“ werden könnte.
Ich frage noch einmal andersherum: Welche Länder haben strukturelle Vorteile im cleveren Umgang mit der digitalen Transformation?
Kleine Länder tun sich wahrscheinlich erst mal leichter, sich neu zu erfinden. Sie können disruptive Schritte rascher umzusetzen. Denken Sie nur an Estland, das die Verwaltung schon lange und auch sehr zügig digitalisiert hat.
China erfindet sich gerade digital ebenfalls neu und ist alles andere als klein…
…allerdings nicht auf eine Art und Weise, die man als aufgeklärter Mitteleuropäer gut finden oder gar kopieren sollte. Anschauungsunterricht bietet China nicht beim „was“, sondern beim „wie“, denn das Land illustriert, wie mächtig ein echtes Zukunfts-Narrativ sein kann. Einer der Gründe, warum die Chinesen so erfolgreich sind, ist doch, dass sie den Aufbruch wollen und auch daran glauben. Wäre es nicht unsere Aufgabe, ein aufgeklärtes Gegennarrativ zu schaffen? Ich glaube schon. Es wäre an uns, eine Art und Weise zu finden, wie wir den Blumenstrauß an neuen Technologien nutzen, um unsere Gesellschaften in Freiheit und Demokratie neu zu erfinden.
Das ist ein gutes Schlusswort. Kommen wir aber trotzdem noch rasch zurück zur Eingangsfrage nach Optimismus und Pessimismus. Ist in dem einen Jahr, das nun seit der Veröffentlichung von „Zukunftsblind“ vergangen ist, etwas passiert, das Sie glauben lässt, dass Deutschland dieses Gegennarrativ bald finden wird?
Ich habe in diesem Jahr die Gelegenheit gehabt, mich mit einigen Politikern zu diesem Thema auszutauschen, und ich glaube weniger als je zuvor, dass wir es mit „dummen Politikern“ zu tun haben. Problembewusstsein ist durchaus da. Das stimmt mich optimistisch. Pessimistisch stimmt mich hingegen die Wohlstandsmüdigkeit im Land, auch und gerade unter Jüngeren. Viele sind laut eigenen Angaben schon zufrieden, wenn es ihnen „so gut geht wie ihren Eltern“. So bricht man als Gesellschaft nicht auf, sondern fällt zurück. Und wenn man’s merkt, ist es vielleicht zu spät.
Benedikt Herles ist Ökonom und Autor. Sein aktuelles Buch „Zukunftsblind“ (Droemer, 2018) – das auch einen 10-Punkte-Plan mit konkreten und durchaus überraschenden Reformideen enthält – wurde auf der Frankfurter Buchmesse 2019 mit dem getAbstract International Book Award ausgezeichnet.
Nächste Schritte
Mehr zum Thema „Digitale Transformation“ finden Sie in unserem zugehörigen Kanal mit über 70 Zusammenfassungen zum Thema. Wer nach dieser Lektüre noch nicht genug (gelernt) hat, findet unter Digitalisierung und Lerntechniken mehrere Dutzend weitere Leseempfehlungen. Für Führungskräfte, die auf der Suche nach konkreten Ideen zum produktiven Umgang mit den neuen digitalen Möglichkeiten sind, empfehlen wir einen Blick auf unsere Sketchnotes – und natürlich Reinhard K. Sprengers Buch „Radikal Digital“.
Weitere Infos zu den Preisträgern des getAbstract International Book Awards 2019 finden Sie hier.